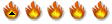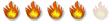Wer das Buch “Und immer weiter zur Sonne“ gelesen hat, weiß, dass ich mich schon auf unserer Reise 2003/04 intensiv mit „The Ghan“ beschäftigt hatte. In Katherine haben wir haben wir uns im September 2003 nahe de Depots “Little Singapore“ mit den Gleisbauern unterhalten. Aber eine Fahrt, gleich nach Streckeneröffnung, passte nicht in unsere damalige Route und war uns außerdem zu teuer. Wir sind bei unseren Reisen nach DU sehr oft im NT gewesen, waren auch drei Mal am Uluru. Doch für eine komplette Tour entlang des Stuart Highway reichte leider nie die Zeit. Auch unser Plan, dies im November/Dezember 2005 nun endlich zu tu, klappte nicht. Der Termin der Buchlesung in Adelaide stand für Anfang Dezember fest und ließ sich nicht verschieben. So sind wir diesmal wenigstens mit „The Ghan“ von Nord nach Süd gereist. Was wir dabei erlebt haben, soll die folgende Geschichte erzählen. Natürlich kann so eine Zugfahrt, selbst wenn sie von den Aussies zur Legende hoch stilisiert wurde, nicht die Reise mit dem Auto ersetzen. So freuen wir uns schon auf Januar 2007. Diesmal wird der Stuart Highway von Darwin bis Adelaide, mit vielen „Seitensprüngen“ gefahren. Und genügend Zeit haben wir auch.
The Legendary Ghan

Die Vorgeschichte über einen der größten Wünsche aller Australier, nämlich eine Zugverbindung von Nord nach Süd zu bekommen, habe ich schon erzählt. Nun also war es auch für uns so weit. Die Fahrt mit dem Überlandexpress Darwin- Adelaide. Doch der Name „North South Overland Train“ passt den Aussies überhaupt nicht. Zu wenig poetisch, zu banal, zu wenig merkantil. „The Legendary Ghan“! Das zieht doch viel eher.
Seit 1863, nachdem Stuart als Erster Australien von Adelaide bis zur Nordküste durchquert hatte, träumen die Aussies von einer solchen Zugverbindung.
Schon 1872 feierte man die Vollendung der Verbindung zwischen Port Augusta und Farina. Mit der Inbetriebnahme der Strecke Darwin (Palmerston) nach Pine Creek 1883 entstand die Idee einer Transkontinentalverbindung. Bis zu deren Verwirklichung sollten aber noch 132 Jahre vergehen. Katherine zierte mit dem einzigen richtigen Bahnhof die Strecke. Dieser wurde bis 1949 auch regelmäßig um- und ausgebaut. Die schlechte Ertragslage in den Goldfeldern und bei der Mineralproduktion führte zu einer immer mehr nachlassenden Auslastung der Züge, die bald nicht mehr täglich fuhren. Andere Transportanbieter waren billiger. Bereits 1975 hatte die NAR (North Australian Railway) ein Defizit von 5 Millionen AUD. So fuhr der letzte Zug auf dieser Strecke am 29. Juni 1976. Offiziell existierte ab 11. Februar 1981 in Katherine kein Bahnhof mehr. Nach der Restaurierung 1982 gehört er heute zum kulturellen Erbe, auch wenn Einwohner und Besucher ihn regelrecht verunstalteten.
Am Anfang der Erschließung oder Durchquerung der Nord- Süd- Passage sind viele Forscher, viele Reisende durch die unsagbaren Schwierigkeiten des Outbacks zum Teil sogar dort gestorben. Pferde halfen bei der Überwindung der Strecke nur wenig. Deshalb wurden die Kamele benötigt. Die meisten kamen von Pakistan, damals eine „Kolonie“, ein Teil von Britisch Indien. Zunächst bewährten sie sich beim Transport der Forscher, später arbeiteten sie für die Siedler und die Miner, die den Entdeckern folgten. Die Kamele und ihre Treiber, meist Afghanen, waren gesellschaftlich nicht anerkannt. Obwohl man sie so sehr brauchte. Da die Aussprache „Afghane“ für die Aussies zu lang war, riefen sie diese Kamelkarawanen einfach „Ghan“. Immer bestand Misstrauen. Deshalb lebten diese großen und offenbar bösartigen Tiere und die fremdländischen Treiber, die Cameleers, gezwungenermaßen am Rande der Ortschaften in „Ghantowns“. Gemieden und entfremdet.
Es lag nicht an den Kamelen, dass die Expedition von Burke und Wills 1860 so tragisch endete. Tausende Melbourner verabschiedeten die Männer zur ersten erfolgreichen Süd- Nord- Durchquerung des Kontinents. Erstmals waren 25 Kamele und 3 Treiber mit von der Partie. Auf dem Rückweg starben Burke und Will den Hungertod. Der dritte Begleiter King wurde von Aborigines gerettet. Tragisch war dabei, dass das Reservelager für den Rücktransport mit der zurückgelassenen Mannschaft unter Leitung des deutschen Wilhelm Brahe nach fast drei Monaten längeren Wartens als verabredet wenige Stunden vor dem Eintreffen der Drei abgebrochen wurde.
Thomas Elder, der 1866 verschiedene Kamele, wie Arbeitstiere, Bergkamele oder auch schnelle Kamele, nach Australien holte, gründete in Südaustralien ein Gestüt, neben dem die erste dieser Ghantowns lag. Als kommerzieller Kamelunternehmer verlieh er seine Kamele für Inlandexpeditionen. Bis 1880 entstanden viele solcher Städte aus Wellblech und Stallungen am Rande der Verkehrszentren. Der Transport war mittlerweile fest in den Händen der afghanischen Kaufleute und Händler. Über den halben Kontinent trugen die Kamele Farmausrüstungen und Bedarfsgüter in Gegenden, wo nicht mal Pferde arbeiten konnten. Die Bilder von Karawanen, bei denen bis zu 70 Tiere durch Stricke an einem Nasenring hintereinander in der glühende Sonne laufen, sind in vielen Museen ausgestellt. Diese Karawanen, von den Caravaneers geführt, sicherten den Nachschub zu den Siedlern und den Minern. Sie brachten Vorräte und nahmen Wolle oder Mineralien mit zurück. Sie halfen den Siedlern beim Bestellen der landwirtschaftlichen Flächen. Und immer sind es diese einbuckligen Dromedare, die aus scheinbar unbetretbaren Gebieten die Waren zu den Häfen, zu anderen Handelszentren transportierten. Die Telegraphenleitung von Port Augusta nach Darwin 1870, der Bau der transaustralischen Eisenbahn durch das Nullabor vierzig Jahre später, wären ohne den Materialtransport durch Kamele nicht möglich gewesen. Haben die Australier ihrem treuen Freund und Helfer seinen Einsatz gedankt, nachdem ab 1930 der motorisierte Transport die Kamele ablöste? Sicher! Sie wurden nicht getötet, nicht gegessen, sondern in unbewohnten Wüstengegenden frei gelassen. Die dort heute noch lebenden Herden sind die Nachkommen des einst treusten und verlässlichsten Partners der Australier
Ein fahrplanmäßiger normaler Zugverkehr auf den 1600 Kilometern zwischen Adelaide und Alice Springs begann 1929. Dieser 3. August 1929 war ein großer Tag in der Geschichte von Südaustralien. Endlich ein Zug von Adelaide nach Stuart, dem heutigen Alice Springs. Vorher hatten die Betreiber die Gleise der ersten Zugverbindung aus einem angeblich trockenen Flussbett noch einmal verlegen müssen, da es doch vorkam, dass Kamele bei Hochwasser den Weitertransport der Passagiere übernahmen. Beim Bau dieser ersten Linie brauchte man noch dringend die Hilfe der Kamele, ohne die ein Materialtransport an die Baustellen undenkbar war. Schwierigkeiten gab es damals ohne Ende. Angeblich sollen sogar Termiten die Holzteile der Strecke in Späne „umgearbeitet“ haben. Die Mär berichtet von einem durch Wasser eingeschlossenen Zug. Hier soll der Lokführer die Passagiere über zwei Wochen mit Wildziegen, die er schoss, ernährt haben. Wahrheit und Legende liegen in Australien nicht nur dicht nebeneinander. Oft sogar aufeinander.

Der Name „Ghan“ für den Zug entstand zu dieser Zeit. Die Kamele halfen mit, sich selbst weg zu rationalisieren. Bis dahin hatten sie den gesamten Transport, ob Lebensmittel, Waren des täglichen Lebens und auch die Post, bewerkstelligt. Diese Bahnlinie ist ein weiterer Sektor in einem Kreis, dessen Ende noch offen ist. Die Cameleers zerstreuten sich, gingen zum Teil wieder zurück in die Heimat, gründeten Läden, verdingten sich als Arbeiter bei der Eisenbahn oder in den Häfen. Es gibt nur wenig greifbare Erinnerungen an die Cameleers oder Caravaneers. Einige Reste von Buschmoscheen, einige Gräber und der Name des Zuges „Ghan“.

Nach langem politischen und wirtschaftlichen Hin- und Her, einem uneffektiven Streit über die Streckenführung der Transkontinentalverbindung übernahm eine internationale private Interessengruppe mit der Investition von über 1,3 Milliarden Dollar die Federführung. Dass dabei die US Amerikaner mit der Firma Halliburton der größte Geldgeber sind? Es wird nur unter der Hand registriert. Die Absicht, über Darwin den Handel mit Asien zu intensivieren, ist die Motivation. Der Personenverkehr folgt nur als eine Zugabe. Was aber, wenn die Handelsunternehmen in Südaustralien die Container weiterhin direkt dort auf die Frachtschiffe verladen? Oder wenn die Transportpreise per Truck billiger sind als per Bahn? In Deutschland an der Ostgrenze haben wir das ja erlebt. Was wird mit den vielen arbeitslosen Truckfahrern, wenn die Strecke wirklich boomt? Was mit den vielen Mitarbeitern der großen Güterverladestation in Alice Springs? In einem waren die Investoren vorausschauend. Sollte der Betrieb der Strecke unwirtschaftlich sein, sollte die Natur sich ihr Territorium zurückholen kann man ja immer noch die zwei Millionen Betonbahnschwellen verkaufen. Jede trägt einen Datumsstempel der Verlegung. Der Sammlerwert ist dann sicher sehr hoch.